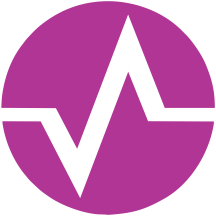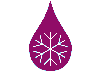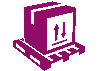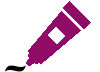Viel hilft nicht immer viel – aber andererseits kann ein heute noch leicht überdimensioniert wirkendes System vielleicht morgen schon an seine Grenzen stoßen. Man kann deshalb wohl nie genug Leistung haben und es gibt auch ein gewisses Gefühl an Zukunfts- und Planungssicherheit, wenn man (berechtigterweise) glaubt, auch für künftige Anforderungen noch gut gerüstet zu sein. Eine solche Annahme kann aufgehen, muss aber nicht. Zunächst wird man sich überlegen müssen, für was der PC in der Gegenwart und näheren Zukunft gerüstet sein muss und was später vielleicht noch hinzukommen könnte. Genau daran sollte man seine Überlegungen ausrichten – und ein klein wenig Reserve einplanen.
3D Gaming-Benchmarks
 Mehr Leistung kostet ja leider auch stets – oft sogar unproportional – mehr Geld, weswegen man den Nutzen einer (massiven) Leistungsreserve äußerst kritisch hinterfragen muss. Wir hatten das Thema ja gerade schon einmal kurz gestreift: Oft genug liegen Anspruch, Wunsch und finanzielle Möglichkeiten nicht sonderlich eng beisammen.
Mehr Leistung kostet ja leider auch stets – oft sogar unproportional – mehr Geld, weswegen man den Nutzen einer (massiven) Leistungsreserve äußerst kritisch hinterfragen muss. Wir hatten das Thema ja gerade schon einmal kurz gestreift: Oft genug liegen Anspruch, Wunsch und finanzielle Möglichkeiten nicht sonderlich eng beisammen.
Doch hier hilft die Wundermedizin “Vernunft”, die den Anwender zu Kompromissbereitschaft und Einsicht in die unabänderlichen Tatsachen führen sollte. Aspekte wie Ökologie (Leistungsaufnahme und Langlebigkeit) und Ökonomie (Aufwand und Nutzen) sollten stets in einem gesunden Verhältnis zueinanderstehen.
Wir schrieben es ja gerade: Man sollte sich am besten wirklich nur das anschaffen, was man wirklich braucht (bzw. in näherer Zukunft noch könnte). Zu den Charts-Ergebnissen der 3D-Gaming-Leistung
3D Workstation-Anwendungen (CAD)
 Allerdings es gibt ja nicht nur das Gaming. Egal, ob nun 2D- oder 3D-Ausgabe – die Anforderungen im (semi-) professionellen Bereich oder dem Home-Office sind sehr vielfältig. Je nach verwendeter Standardsoftware oder den Programm-Suiten stößt man auf sehr langlebige Software-Produkte mit einem oft mehrjährigen Nutzungs-Zyklus.
Allerdings es gibt ja nicht nur das Gaming. Egal, ob nun 2D- oder 3D-Ausgabe – die Anforderungen im (semi-) professionellen Bereich oder dem Home-Office sind sehr vielfältig. Je nach verwendeter Standardsoftware oder den Programm-Suiten stößt man auf sehr langlebige Software-Produkte mit einem oft mehrjährigen Nutzungs-Zyklus.
Das beinhaltet auch, dass viele (ältere) Programme eher (noch) auf eine hohe IPC setzen und kaum über viele Threads ordentlich skalieren, oder aber im Gegenzug parallel auch Berechnungen durchführt werden, deren Last so hoch ist, dass bei falsch eingesetzten CPUs die Performance der Grafikausgabe überproportional leidet. Zu den Charts-Ergebnissen der 3D-Workstation-Leistung
Compute-Leistung
 Das ideale Gegenbeispiel zu reinen 3D-Anwendungen sind echte Rendering- oder Compute-Aufgaben. Hier werden die Karten oft genug neu gemischt, denn nicht immer steht die IPC im Vordergrund, sondern die Anzahl der verfügbaren Kerne bzw. Threads. Multi-Threading wird groß geschrieben und am Ende zählen auch physikalisch vorhandene Kerne mehr, als HT oder SMT.
Das ideale Gegenbeispiel zu reinen 3D-Anwendungen sind echte Rendering- oder Compute-Aufgaben. Hier werden die Karten oft genug neu gemischt, denn nicht immer steht die IPC im Vordergrund, sondern die Anzahl der verfügbaren Kerne bzw. Threads. Multi-Threading wird groß geschrieben und am Ende zählen auch physikalisch vorhandene Kerne mehr, als HT oder SMT.
Wer mit der CPU auch (oder überwiegend) Videos encodiert oder rechenintensive Aufgaben lösen möchte, die sich gut parallelisieren lassen, sollte sich diese Benchmarks auf jeden Fall einmal genauer ansehen. Zu den Charts-Ergebnissen der Compute-Leistung
Leistungsaufnahme-Messungen im Detail
 Wir messen die Leistungsaufnahme fürs Package bzw. die gesamte CPU direkt hinter den Spannungswandlern, deren Verluste man natürlich ebenfalls noch mit einplanen sollte. Der Vorteil unserer Direktmessung bzw. Sensorerfassung liegt darin, dass die Werte unabhängig vom Mainboard und dessen Effizienz ermittelt werden. Das hilft später bei der besseren Vergleichbarkeit. Spiele und Workstation-Workloads können sehr unterschiedlich bei der erforderlichen Leistungsaufnahme sein, je nach tatsächlicher CPU-Last.
Wir messen die Leistungsaufnahme fürs Package bzw. die gesamte CPU direkt hinter den Spannungswandlern, deren Verluste man natürlich ebenfalls noch mit einplanen sollte. Der Vorteil unserer Direktmessung bzw. Sensorerfassung liegt darin, dass die Werte unabhängig vom Mainboard und dessen Effizienz ermittelt werden. Das hilft später bei der besseren Vergleichbarkeit. Spiele und Workstation-Workloads können sehr unterschiedlich bei der erforderlichen Leistungsaufnahme sein, je nach tatsächlicher CPU-Last.
Unsere Beispiele zeigen deshalb jeweils ein eher durchschnittliches Szenario, welches dem Durchschnittswert aus allen Spielen und Anwendungen unserer Suite am ehesten entspricht. Dabei liegen die CPUs noch unterhalb der angegebenen TDP, was einmal mehr zeigt, dass diese lediglich ein Richtwert für die Auslegung der Kühlung ist, allerdings eben nicht ausschließlich. Zu den Charts-Ergebnissen der CPU-Leistungsaufnahme
Das Test-Setup
Die Test-Methodik vieler Dinge haben wir in ja bereits immer wieder sehr ausführlich beschrieben und so verweisen wir deshalb der Einfachheit halber jetzt nur noch auf diese detaillierte Schilderung. Den Rest gibt es hier noch einmal zum Nachlesen:
Abweichend ist bei den einzelnen Sockeltypen natürlich die Hardwarekonfiguration mit CPU, RAM, Mainboard, während wir bei der Kühlung generell auf unser zentrales Kühlsystem im Labor mit einem potenten Chiller setzen. Die Zusammenfassung in Tabellenform gibt nun einen kurzen Überblick über die jeweiligen Konfigurationen
| Testsysteme und Messräume | |
|---|---|
| Hardware: |
AMD Socket AM4 (400er) AMD Ryzen 7 und Ryzen 5 der zweiten Generation MSI X470 Gaming M7 AC 2x 8GB G.Skill FlareX DDR4-3200 @ DDR4-2667, DDR4-3466 AMD Sockel AM4 (300er) AMD Sockel SP3 (TR4) AMD Sockel AM3+ Intel LGA 1151 (Z370): Intel LGA 1151 (Z270) Intel LGA 1151 (Z170) Intel LGA 1150 (Z97A) Intel LGA 1150 (Z97) Intel LGA 2066 Intel Sockel 2011 v3: Alle Systeme: |
| Kühlung: |
Alphacool Eiszeit 2000 Chiller Alphacool Eisblock XPX Thermal Grizzly Kryonaut (für Kühlerwechsel) |
| Monitor: | Eizo EV3237-BK |
| Gehäuse: |
Lian Li PC-T70 mit Erweiterungskit und Modifikationen Modi: Open Benchtable, Closed Case |
| Leistungsaufnahme: |
berührungslose Gleichstrommessung am PCIe-Slot (Riser-Card) berührungslose Gleichstrommessung an der externen PCIe-Stromversorgung direkte Spannungsmessung an den Shunts, den jeweiligen Zuführungen und am Netzteil Auslesen der Mainboard-Sensoren 2x Rohde & Schwarz HMO 3054, 500 MHz Mehrkanal-Oszillograph mit Speicherfunktion 4x Rohde & Schwarz HZO50, Stromzangenadapter (1 mA bis 30 A, 100 KHz, DC) 4x Rohde & Schwarz HZ355, Tastteiler (10:1, 500 MHz) 1x Rohde & Schwarz HMC 8012, Digitalmultimeter mit Speicherfunktion |
| Thermografie: |
Optris PI640, Infrarotkamera PI Connect Auswertungssoftware mit Profilen |
| Akustik: |
NTI Audio M2211 (mit Kalibrierungsdatei) Steinberg UR12 (mit Phantomspeisung für die Mikrofone) Creative X7, Smaart v.7 eigener reflexionsarmer Messraum, 3,5 x 1,8 x 2,2 m (LxTxH) Axialmessungen, lotrecht zur Mitte der Schallquelle(n), Messabstand 50 cm Geräuschentwicklung in dBA (Slow) als RTA-Messung Frequenzspektrum als Grafik |